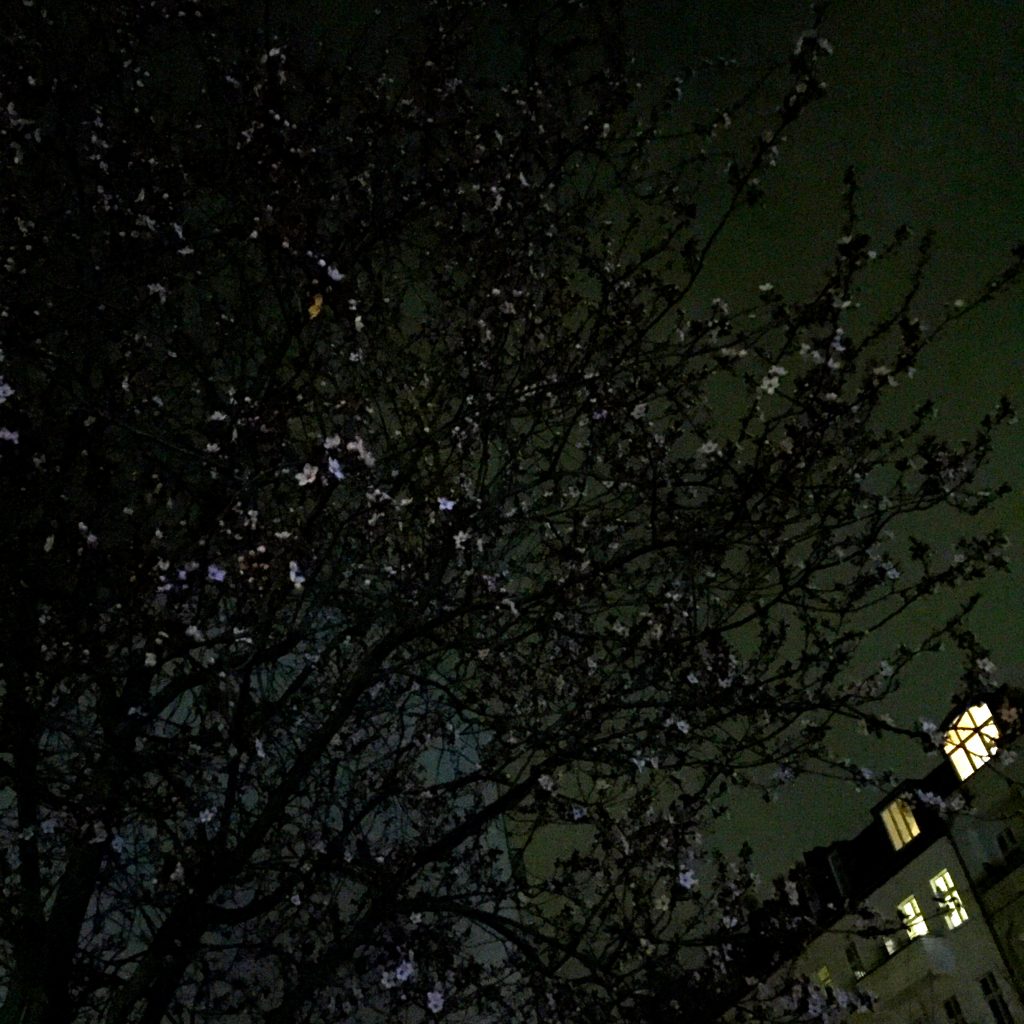O komm, Geliebte, komm, es sinkt die Nacht,
Verscheuche mir durch deiner Schönheit Pracht
Des Zweifels Dunkel! Nimm den Krug und trink,
Eh‘ man aus unserm Staube Krüge macht.
Omar Hayyam
Am Ende der Woche aber stehe ich bei P&C am Leipziger Platz und ziehe ein Kleid nach dem anderen an. Abstrakt mag ich starke Farben und Muster, aber rein praktisch sehe ich auch heute in den bunten Kleidern irgendwie sonderbar aus, und verlasse das Kaufhaus wieder mit Kleidung in beige und blau. Ich bin nämlich nicht nur Juristin. Ich ziehe mich auch so an.
In den Umkleidekabinen neben mir wird gelacht. Zwei Mütter und zwei Töchter probieren Kleider, offenbar für den Abiball, und die beiden Mädchen treten nacheinander in den tollsten Kleidern vor den Spiegel. Groß und rothaarig ist die eine, mit weißer Haut und schlanken Armen. Blond und strahlend die andere. Noch ganz glatt sind ihre Oberarme und Rücken, ihre Haare sehen, man kann es nicht anders sagen, saftig aus, und sicherlich sind auch ihre Zähne besser als meine. Ihre Mütter wirken dagegen fleckig und zerknittert, und auch ich mache in meinen blauen Etuikleidern vermutlich keine besonders gute Figur.
Für einen Moment beneide ich die Mädchen um ihre Vitalität. Die können bestimmt auch noch ausgehen, ohne sich tagelang zu fühlen wie Hackfleisch. Dann aber fällt mir ein, wie ich mit 19 in einem cremeweißen Kleid auf meinem Abiball stand; ich hielt gemeinsam mit einem Freund die Abirede und sah, glaubt man den Bildern, eigentlich wirklich ziemlich gut aus. Ich war ziemlich schlank, weil ich dreimal die Woche beim Sport war, ziemlich braun, weil ich immer draußen war, ich hatte lange, schwarze Haare und mein Kleid stand mir.
Ich fühlte mich fürchterlich.
Dass ich die verdammte Rede nicht hinter einem Vorhang halten konnte, setzte mir ernsthaft zu. Aus irgendeinem Grund nahm ich an, dass sowieso niemand mit mir tanzen wollen würde und behauptete deswegen, ich hätte zum Tanzen keine Lust. Ich hielt mich für eine etwas schwierige Einzelgängerin, dabei war ich im Vorjahr im Schülersprecherteam gewesen, feierte den ganzen Sommer bei lauter Leuten, die mich schließlich aus irgendeinem Grunde eingeladen haben mussten, und außerdem hielt ich mich für erotisch unvermittelbar, dabei stand mein Freund neben mir und mein Exfreund schlich irgendwo beleidigt um die Säulen.
Ich hätte eine großartige Zeit haben können. Ich wünschte, ich hätte sie gehabt. Wenn ich den fremden Mädchen in der Umkleidekabine neben mir einen Rat geben könnte, würde ich ihnen raten, sich für diesen Sommer zwischen Schule und Studium unwiderstehlich, unbesiegbar und wunderschön zu fühlen, und jedes Geschenk, jedes Lächeln und jedes Kompliment als berechtigten Tribut mitzunehmen, den das Leben ihnen vor die Füße wirft.
Doch die Mädchen bemerken mich nicht einmal, ich kaufe zwei blaue Kleider und einen Trenchcoat in beige, und im Gehen frage ich mich nur flüchtig, was mir in wiederum zwanzig Jahren leidtun wird von dem, was ich heute denke, mache, sage. Lasse.