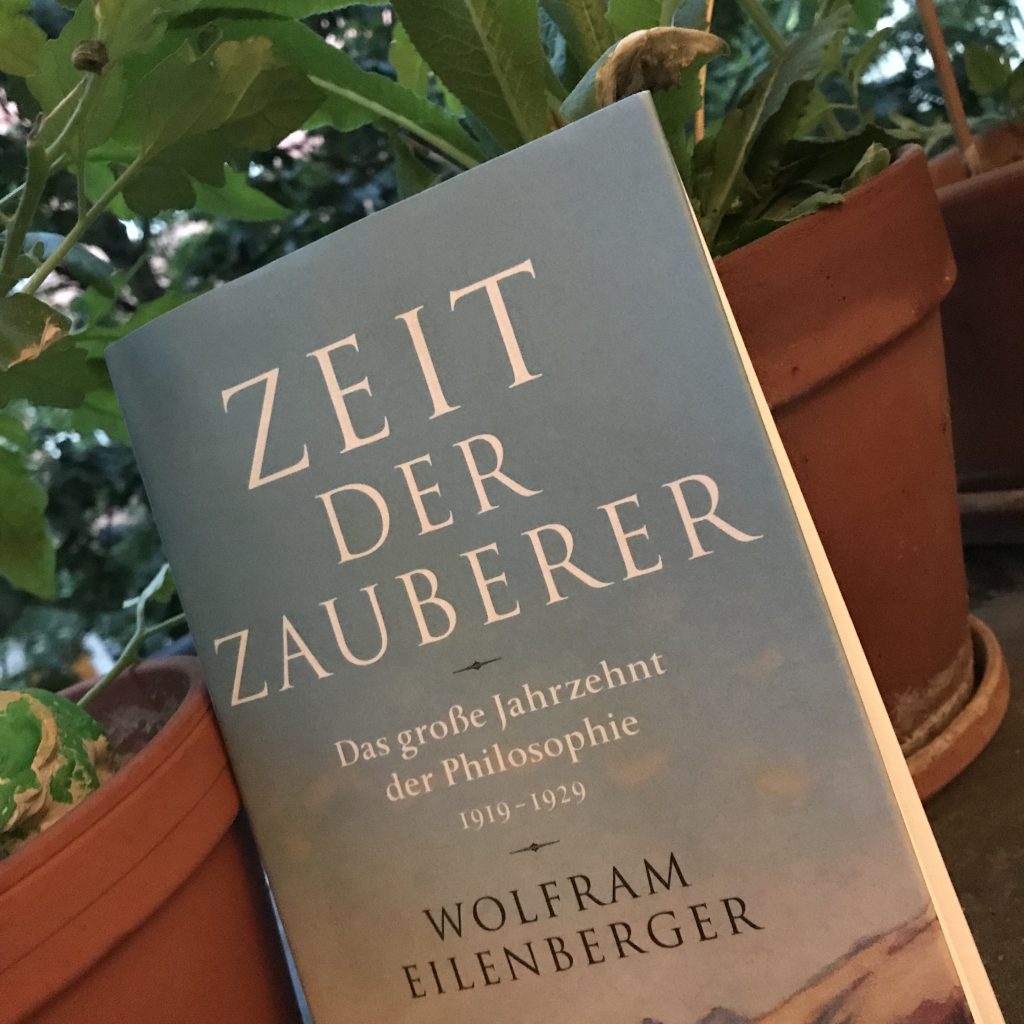Ich wusste gar nicht, dass du dich auch für Zauberer interessierst, schwenkt ein begeisterter F. mein neues Buch durch die Küche. Zeit der Zauberer steht da weiß vor blauem Himmel, und der neugierige F. hat es von meinem Nachttisch geklaubt. Klaro, sage ich, strecke die Arme aus und F. samt Buch sitzen auf meinem Schoß. Der F. ist in den letzten Monaten wahnsinnig gewachsen und trägt seit kurzem Größe 122. Wenn er auf meinem Schoß sitzt, berühren seine Füße den Boden.
„Gibt es Bilder?“, fragt mich der F., und ich fange an, zu blättern. „Der sieht ja ganz normal aus.“, sagt der F. und schaut Walter Benjamin an. Knietief steht seine Enttäuschung auf den Dielen: Sogar die Zauberer, die seine Mutter mag, sehen langweilig aus und tragen nicht mal Hüte.
„Er war ein besonderer Zauberer, weißt du.“, streiche ich dem F. den schon wieder ein klein bisschen zu langen Pony aus der Stirn. Dass er aus Berlin stammte, erzähle ich ihm. Dass er über Kunst und die damals noch recht neue Fotografie geschrieben hat, über Gott und seine Kindheit als kleiner Junge in einem Berlin, das einerseits ganz anders war als das des F., aber in gewisser Weise auch wiederum gar nicht. Dass er gestorben ist, als er vor Hitler weglief. Vor Hitler wegzulaufen kennt der F. schon, der in einer Stadt voller Toter groß wird, in der die Fassaden manchmal noch Einschusslöcher haben und in jeder Ecke Geschichten kauern und auf den warten, der sie hören will.
Dass ich die Zaubersprüche von Martin Heidegger nie verstanden habe, der ein anderer Zauberer ist, von dem das Buch handelt, beichte ich dem F., der sich noch nicht vorstellen kann, dass seine allwissenden Eltern für Bücher zu dumm sein können. Dass ich von Cassirer, obwohl der F. selbst sehr, sehr, sehr entfernt mit ihm verwandt ist, gar nichts gelesen habe, weil ich den Neukantianismus zu langweilig finde, um mich länger damit zu beschäftigen, erzähle ich ihm und dann google ich für den F. erst einmal Kant selbst. Der Zauberer sieht mehr aus wie ein Zauberer, sagt F., dessen Zaubererbild maßgeblich von dem großen und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann geprägt sein dürfte. Kant findet er aber gut, weil er es gut findet, wenn Menschen sehr vernünftig sind, weil sie dann niemanden verletzen und auch nicht grundlos herumschreien. Der F. hat nämlich eine handfeste Abneigung gegen Krach.
Wittgenstein habe ich auch nicht verstanden, sage ich dem F., der mich inzwischen vermutlich für einen geistigen Totalausfall hält, und versuche ihm zu erklären, dass nicht nur das, was man machen soll, der Sinn dieser ganz besonderen Zauberei darstellt, sondern dass es auch darum geht, zu verstehen, was die Welt ist, was Sprache ist, was Begriffe sind und ob sie etwas zu tun haben mit dem, wofür sie stehen, und der F. hört mir aufmerksam zu. Ob das Buch auch Zaubersprüche enthält, fragt er mich, und dann gehe ich mit ihm nach nebenan, dort, wo unsere Bücher stehen, und lese ihm ein paar Sätze aus dem TLP vor.
„Es ändert sich nichts.“, sagt der F., schaut sich um und hebt die Hände mit den Handflächen nach oben bis auf Brusthöhe an wie sein Großvater es manchmal tut, aber ich nehme ihn auf meinen Arm und lege meine Wange an sein weiches, kühles Gesicht und flüstere ihm zu: Das stimmt nicht. Es ändert sich alles. Alles. Alles.