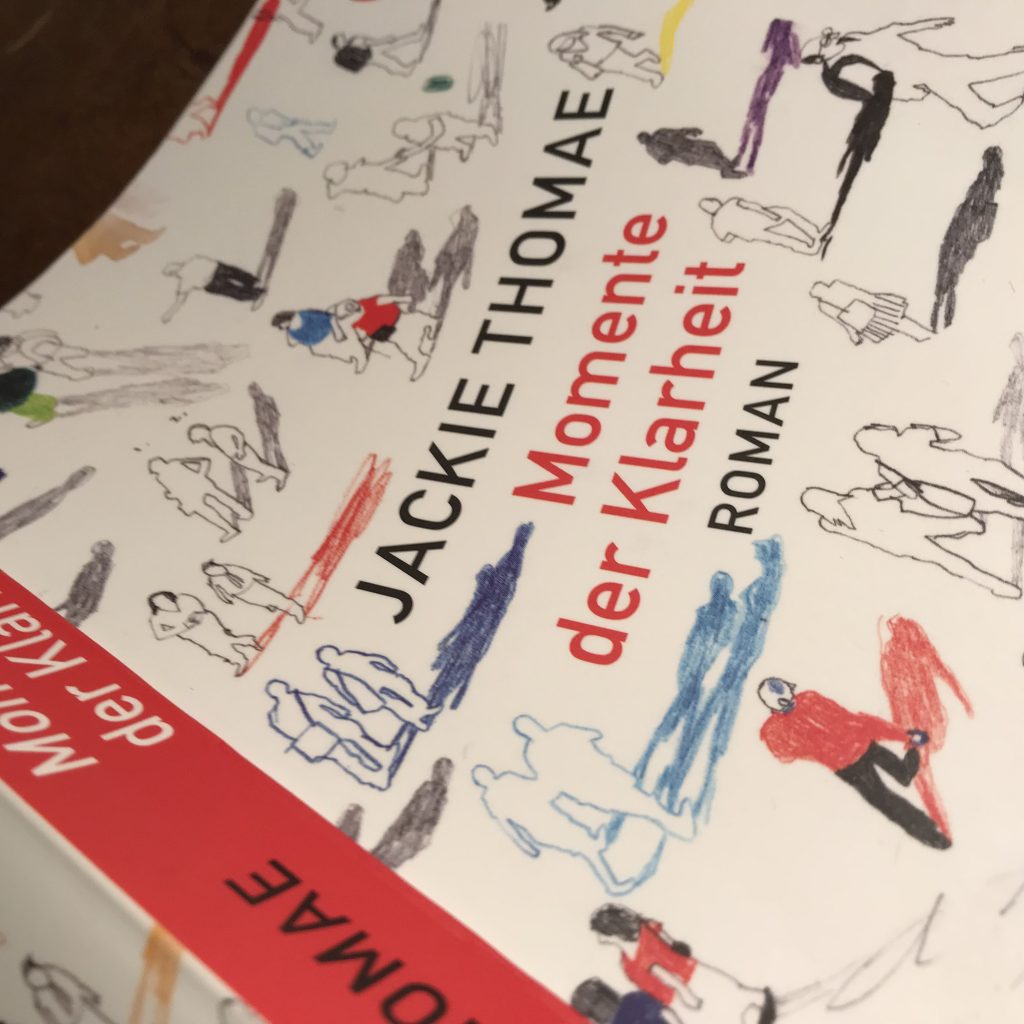Geben Sie ruhig zu: Sie machen das auch. Ich jedenfalls – allerdings fällt mir das aus naheliegenden Gründen auch etwas leichter als anderen Leuten – tue jedenfalls fast schon regelmäßig so, als verstünde ich kein Deutsch, wenn es mir gerade in den Kram passt, und auch meine liebe Freundin A. hebt auf absolut entwaffnende Art und Weise hilflos die Schultern, wenn Leute sie in unerwünschte Gespräche verwickeln wollen. Meistens erspart diese kleine, ganz und gar harmlose Flunkerei einem selbst zähe Konversationen. Manchmal aber, wenn auch ganz selten, geht das schief.
Die A. beispielsweise saß vor fast 20 Jahren in einem ICE und fuhr nach Hause. Die A. stammt nicht aus Berlin, sondern aus einer Kleinstadt in Hessen, und die Hessen, sagt sie, seien überaus gesprächig, dabei zudem entsetzlich distanzlos, und so hatte sie sich mit einer US Vogue präpariert und blätterte durch die mehrere hundert Seiten Werbung, aus denen dieses Periodikum besteht.
Der S. ließ sich jedoch hiervon nicht abhalten. Die A. hat seither bei solchen Gelegenheiten immer Zeitschriften in völlig abwegigen Sprachen gekauft. Die Vogue gibt es immerhin in vielen Ländern. Aber damals sah der S. sie erst an, dann sprach er sie an, natürlich auf englisch, sie nannte ihm einen englischen Allerweltsnamen, und schließlich verabredete er sich mit ihr am folgenden Tage. Der S. war damals sehr attraktiv. Die A. ging also hin.
Die A. war damals, heute darf man sagen, vielleicht ein wenig leichtlebig. Außerdem war ihr heutiger Mann damals noch längst nicht so amüsant wie heute. Die A. blieb also über Nacht.
Nun ist es ein wenig schwer, nach dem Anknüpfen einer Bekanntschaft irgendwann zu gestehen, dass man zum einen nicht heisst, wie man zu heißen behauptet hat. Und auch nicht Engländerin ist. Und erst recht unmöglich erscheint dies am Morgen nach einer gemeinsamen Nacht, und so blieb die A. kurzerhand bei dieser Version, richtete eine E-Mail-Adresse für ihren englischen Namen ein und kommunizierte in den nächsten Jahren immer mal wieder mit dem S. über diesen Kanal. Ab und zu traf man auch mal aufeinander. Dann verlor sich der Kontakt.
Mehr als ein Jahrzehnt dachte die A. nie an den S. Mein Gott, man kann schließlich nicht an jeden denken, insbesondere dann nicht, wenn, wie im Falle der A., schon fast jeder, den man so trifft, ziemlich ausführlich an einen selbst. denkt, denn die A. ist sehr einnehmend und überaus schön. Ein ausgewogenes Gegenseitigkeitsverhältnis im Einzelfall ist da vielleicht ein bisschen viel verlangt. Vermutlich hätte die A. den S. in den nächsten Jahren ganz und gar vergessen, wenn er nicht auf einmal auf einem Gartenfest vor ihr gestanden hätte, das die A. mit ihrem Mann im Sommer besuchte.
Der Gastgeber stellte die A. und den S. einander vor. Die A. natürlich mit ihrem richtigen Namen. Die A. lächelte also freundlich, betrieb Konversation, zeigte keinerlei Zeichen des Erkennens und wich dem S. tendenziell schon eher so ein wenig aus. Der S. schaute stirnrunzelnd ein paarmal zur A. hinüber, aber dann ging alles gut, der S. ging irgendwann, die A. und ihr Mann gingen auch. Die A. atmete auf.
Einige Wochen später jedoch erhielt die A. eine Freundschaftsanfrage auf facebook. Man hat gemeinsame Freunde, an sich ist das nicht näher erstaunlich, man stellte auch schnell Gemeinsamkeiten fest, und weil der S. immer noch ungemein attraktiv ist, verabredete man sich tatsächlich in einem Café. Da saßen sie also, die A. und der S., und aßen Torte und tranken Tee.

Die A. wartete und sah den S. von der Seite an. Der S. lächelte, charmierte, erzählte von zuhause, was er so beruflich macht, und irgendwann, es war spät geworden, strahlte er die A. an und nahm ihre Hand. Sie würde, so sagte er, ihn an ein Mädchen erinnern, das er einmal kannte. Oh, sagte die A. Ja, nickte der S. Lange sei das her. Eine Engländerin sei das gewesen, fuhr er fort. Leider sei damals nichts draus geworden.
Er habe, so sagte er, sie sehr geliebt.