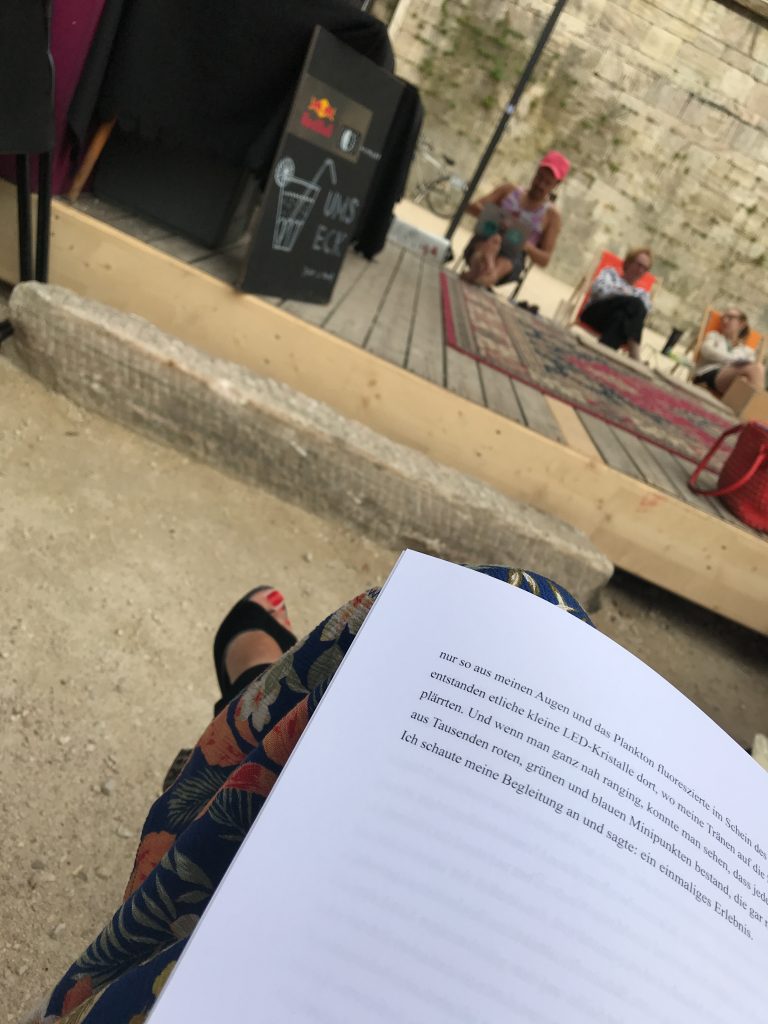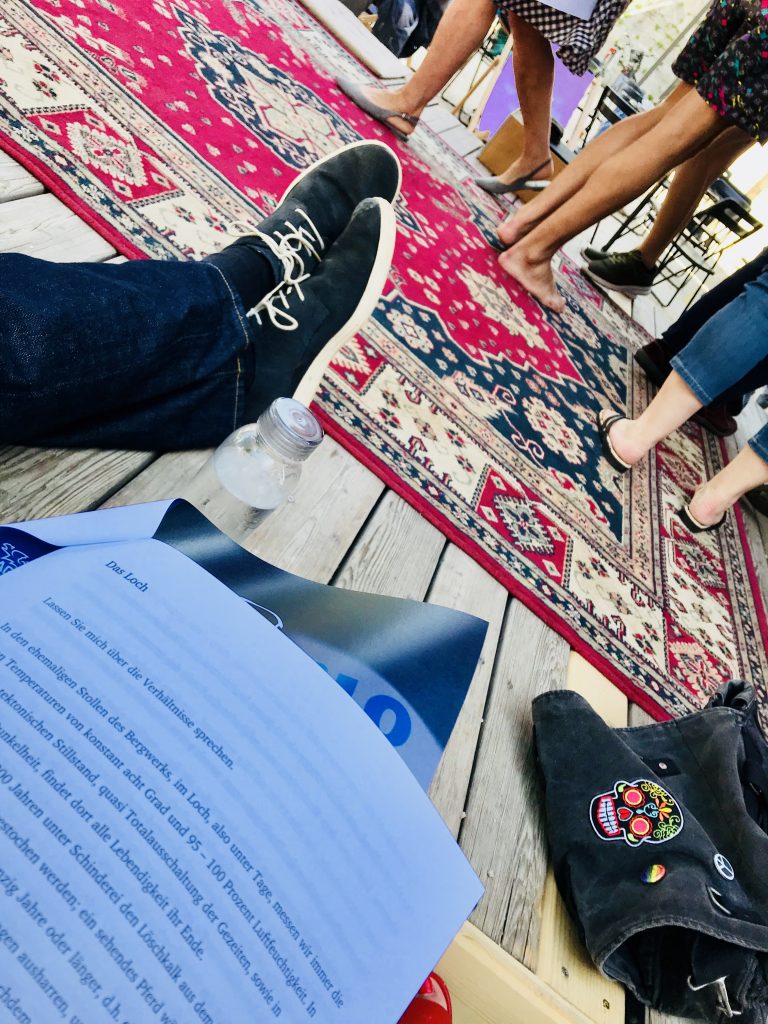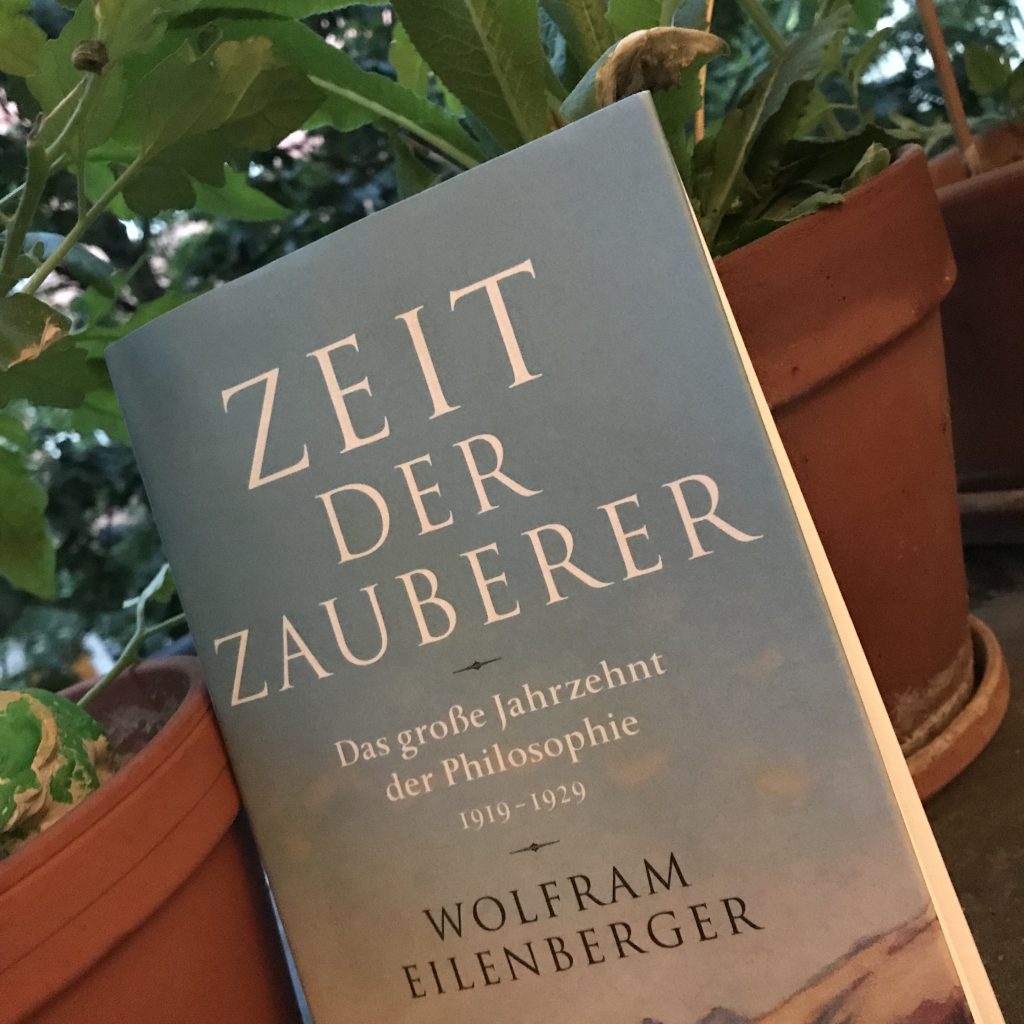Irgendwo müssen sie sein: Die aufregenden Texte, die Texte, die man nach Jahren nicht vergisst. Von denen man manchmal träumt. Um es kurz zu machen: So ein Text war nicht dabei. Ich werde die Texte des heutigen Tages voraussichtlich rückstandslos vergessen.
Der Tag startete mit Raphaela Edelbauer (Text); im Nachhinein mein Favorit. Frau Edelbauers Text war, man kann es nicht anders sagen, gepflegt. Ein Ausfüllungstechniker, ein gescheiterter Akademiker, kommt in eine Stadt, die unterspült ist durch ein Bergwerk. Das Bergwerk hat eine dunkle Geschichte, Weltkrieg, Nazis, Mörder: Alles dabei. Ein paar starke Momente, wie das Schwimmbad sich plötzlich leert. Wie es im Untergrund arbeitet, wie das Es das Ich zu verschlingen droht. Die Metaphorik ist etwas aufdringlich, Edelbauer erzählt vom Untergrund wie von einem Körper, aus dem es quillt, in dem man eindringt, und den der Techniker nun erstarren lässt. Der Preis der Sicherheit ist Leblosigkeit. Das ist vermutlich sachlich zutreffend, aber keine sehr originelle Erkenntnis. Der Text ist solide gemacht, aber er erschöpft sich in der reinen Metapher. Das ist mir zu wenig. Die Bezüge zu Kafkas Schloss, zu King sind geschickt gesetzt, aber sie weisen nicht über den Text hinaus. Gleichwohl: Man traut der Autorin zu, dass ihr Text in den nächsten Kapiteln gewinnt.
Immerhin. Der nächste Text von Martina Clavadetscher (Text) hat mich fast in den auch wärmebedingten Tiefschlaf getrieben. Es geht um eine Schneiderin, Schweiz. Kleine Verhältnisse, rücksichtslose Männer, geduckt, nie gesprochen, und dann stirbt sie und erzählt auf dem Weg ins Krematorium ihre Geschichte, bis sie sich in ein Insekt verwandelt.
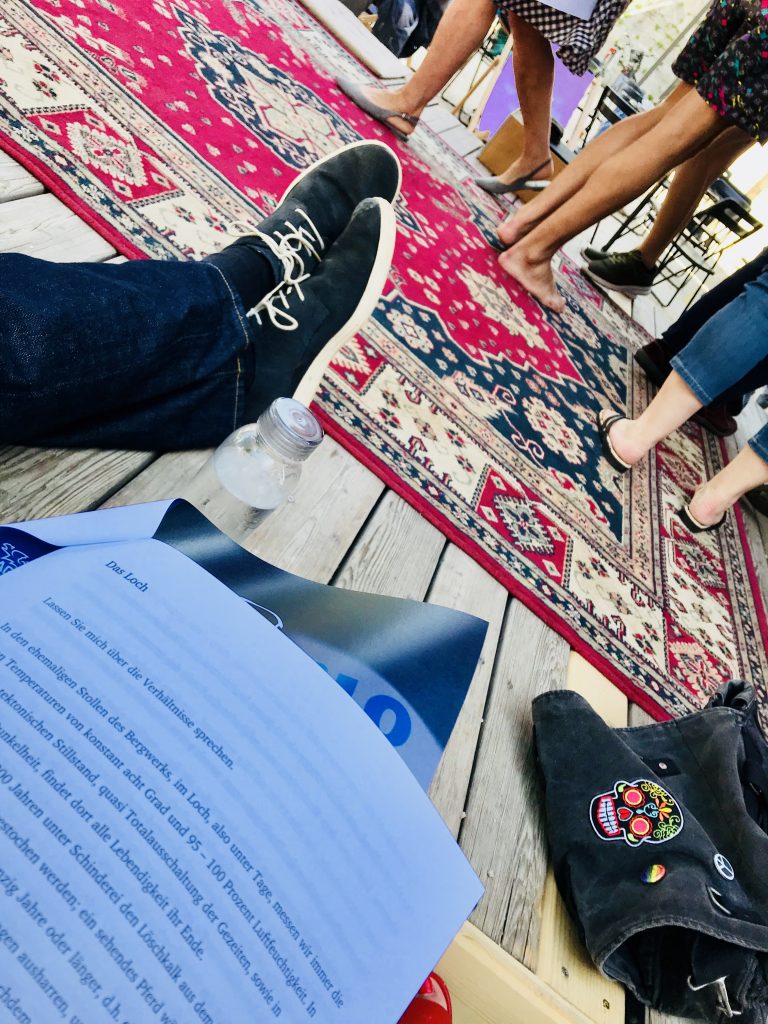
Nun sind Insektengeschichten heikel, weil es immer schwierig ist, mit einer Insektenverwandlung neben der einen großen Verwandlung zu bestehen. Aber so fad sollte es dann doch nicht sein. Frau Clavadetscher schafft es nicht, die ehemals schöne, nun alte und tote Louisa näherzubringen, und das hat vor allem mit Sprache zu tun. Sie spricht nicht wie eine alte, etwas schlichte Frau. Hier fehlt es handwerklich, und das schafft Distanz. Ich habe nicht eine Minute an Louisa geglaubt.
Inzwischen war die Sonne um den Lendhafen herumgewandert und es wurde wahnsinnig heiß. In meiner Klagenfurttasche – dieses Jahr aus Filz – schmolz der schokoladige Kern einer Packung Toffifee.
Nach diesem nicht sehr ärgerlichen, aber sehr langweiligen Text las Stefan Lohse. Sein Text handelt von zwei Jungen, vielleicht 20, von denen einer sich mit dem kongolesischen Befreiungskrieger Patrice Lumumba identifiziert, bis er sich von seinen Freunden sogar so nennen lässt. Der andere ist dick und schwul, der eine verliebt sich in eine Prostituierte, und beide wären gern sehr weit weg. So weit, so gut. Freundschaften und Coming of Age Geschichten kann man ja immer gut hören, aber geht man näher an die Geschichte heran, fehlt dann doch Einiges. Zum einen: Was soll die Darstellung der Geschichte des echten Lumumba? Für diese Story reicht es doch, dass es sich um einen Freiheitskämpfer handelt. Warum die Ausstaffierung der Story mit Elendsfolklore? Die Ausstellung der Accessoires der Unterschicht ist riskant. Zudem: Wozu? Dass die Familie wenig Geld hat, ließe sich auch dezenter darstellen. Interessanter die Freundschaft, aber von der erfährt man nur in Andeutungen.
Vom nächsten Text bekomme ich nicht viel mit. Ich esse sehr gutes Tatar, ich spreche über alles Mögliche, aber dann sitze ich wieder am Lendhafen, verscheuche meine Nachmittagsmüdigkeit mit viel starkem Kaffee und höre die zweite Hälfte eines Textes von Anna Stern (Text). Vielleicht liegt’s an dieser Unvollständigkeit, vielleicht am Text: Ich verstehe ihn nicht. Da liegt also eine Schwangere in Schottland im Koma, ihr Freund ist gekommen, mit dem sie wohl Streit hatte, und irgendwie spielt ein Flugzeug mit, das dort vor vielen Jahren abgestürzt ist. Natürlich schweigt die Schwangere, die liegt ja im Koma. Dafür reden die anderen Leute am Krankenbett, die Namen tragen, bei denen ich leider die ganze Zeit an Loriot denken muss, genauer gesagt: An Evelyn Hamann, wie sie als Ansagerin eine Fernsehsendung ankündigt, die in England spielt. Mir hat sich nicht mal erschlossen, was für Leute das sind, wo sie herkommen, und auch nicht, was eigentlich passiert ist. Schließlich gehen die meisten Schwangeren nie allein ins Hochland.
Ich spare mir allzu naheliegende Witze über Koma und diesen auch ziemlich langweiligen Text und trinke noch einen Kaffee. Kaffee kochen können sie hier. Dann warte ich auf den letzten Text des Tages: Joshua Groß (Text) liest eine Kurzgeschichte über einen Hipster in Miami.
Es tut mir leid, vielleicht bin ich auch für diesen Text schlicht zu alt. Groß‘ Hipster hat irgendein Stipendium, er geht zu einem Basketballspiel, er lernt ein Mädchen kennen und dann noch ein Mädchen, und während das eine Mädchen ihm drögen- und alkoholbedingt über das Hemd kotzt, kommt er dem anderen Mädchen näher und wird – das wird aber nur in einem Halbsatz erzählt – mit diesem Mädchen eine unglückliche Beziehung führen, die mit Abtreibung und Psychiatrie endet.
Ansonsten hat Groß Hipster Simon-Strauss-Probleme. Er fühlt sich ärgerlich unbedeutend und schicksalslos, er hat das Gefühl, in dieselbe biographische Falle wie seine Eltern zu tappen, er wünscht sich „Mystik und Existenzialismus“, aber alles, was er bekommt, sind kotzende Mädchen in Miami — Ich kann mir vorstellen, dass sich das für Zwanzigjährige doof anfühlt, aber ich bin mehr als doppelt so alt, und diese Probleme machen mich ungeduldig. Ich hoffe, Groß hat seinen Text als Satire angelegt, aber seien wir ehrlich: Satire, die man nicht gleich erkennt, ist vielleicht keine gute Satire.
Weil er seinen Text mit Produktnamen und Drogen ausstaffiert, freut sich die Jury. Ich freue mich nicht. Ich bin mit Drogen- und Markennamen eigentlich seit den Neunzigern durch. Wenn ich das nochmal lesen will, lese ich Bret Easton Ellis „Unter Null“, der den Horror Vacui an der Schwelle zum Erwachsensein so gut beschrieben hat, dass es eigentlich niemand mehr machen muss. Ich finde es eigentlich selbstverständlich, selbstverständlicher als die Jury offenbar, dass ein Autor nicht von einem „Kurznachrichtendienst“ spricht, sondern von WhatsApp, und nicht von einem elektronisch gestützten Bezahlsystem, sondern von PayPal. So reden, leben und denken Leute nun einmal, und auf dem Weg zurück vom ORF-Theater zum Hotel sehne ich mich nach Sensationen, nach Klarheit, Härte der Sprache, nach kristallinen Abgründen, den schwarzen Locken der Sprache, Spiel und Exzess.
Aber schauen wir, was der morgige Tag so bringt.