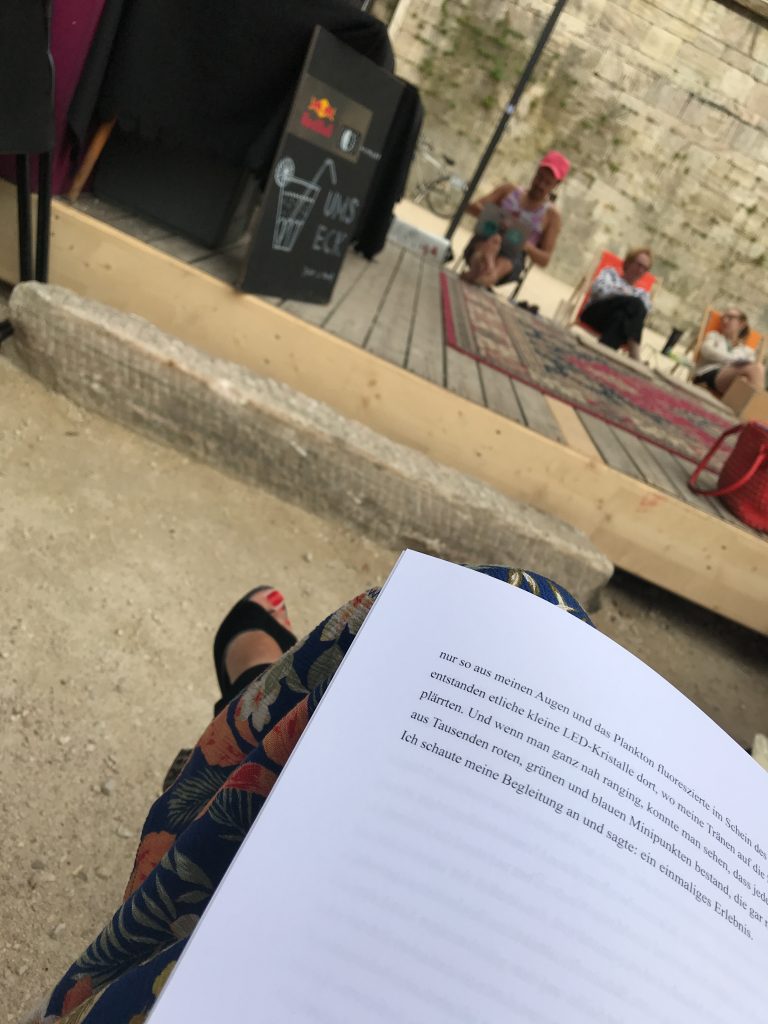Es gibt Shakshuka. Ich schneide Paprika, Zwiebeln, öffne eine Dose Tomaten und brate Harissa an. Der J. kocht Kaffee mit seiner stöhnenden, blubbernden Maschine und Freundin J. 2 sitzt am Küchentisch hinter dem weiß-rosa Strauß, den sie mir mitgebracht hat, und erzählt.
Vermutlich wiegt die sportliche J.2 zehn Kilo weniger als ich, und ich stelle erfreut fest, dass mich das nicht mehr stört. Vor zehn Jahren habe ich ziemlich viel über mein Aussehen nachgedacht, aber heute schiebe ich Paprika und Zwiebeln durch meine Pfanne und es ist mir gleich. Einerseits ist das ziemlich super, andererseits auch ein bisschen unheimlich und hoffentlich nicht der erste Schritt auf der abschüssigen Bahn der verlotterten Leute, die man manchmal in der U-Bahn sieht.
Als die J.2 gegangen ist, gehen wir auf den Markt. Bei uns gibt es einen kleinen Markt, eine Zeile Gemüse und Obst, Fisch und Fleisch, ein paar Stände mit Essen und Wein, immer ein paar Nachbarn mit ihren Kindern, und wir kaufen Zuckerschoten und Radieschen, Melone und Blaubeeren. Abends soll gegrillt werden, beschließen wir und kaufen dafür ein, und dann sitze ich auf dem Balkon, lese, und der F. sitzt neben mir auf dem Sofa und blättert glucksend in ein paar Comics. „Asterix und die Briten“ ist sein Favorit.
Nachmittags treffe ich Freund J.2 auf dem Spielplatz. Eigentlich laufen wir die ganze Zeit hinter seinem Jüngsten zwischen den Spielgeräten hin und her, erzählen uns was über unsere Jobs, über Zukunft und Vergangenheit, beschweren uns, dass wir zu wenig unternehmen und nehmen uns vor, die nächste Spielzeit aber mal so richtig mitzunehmen, auch wenn wir beide wissen, dass wir uns das seit Jahren vornehmen, aber es nie so richtig klappt.
Am Abend liege ich auf dem Sofa. Ich lese Zeitung, ich plane Ausflüge nach Hamburg und Wien, ich schaue mir im Internet die Urlaubsbilder meiner Freunde an und dann lese ich, halb schon im Einschlafen, zwei Gedichte, die ich einmal sehr mochte, und frage mich, ob ich noch einmal so berührbar sein werde, dass mich Lyrik erreicht.