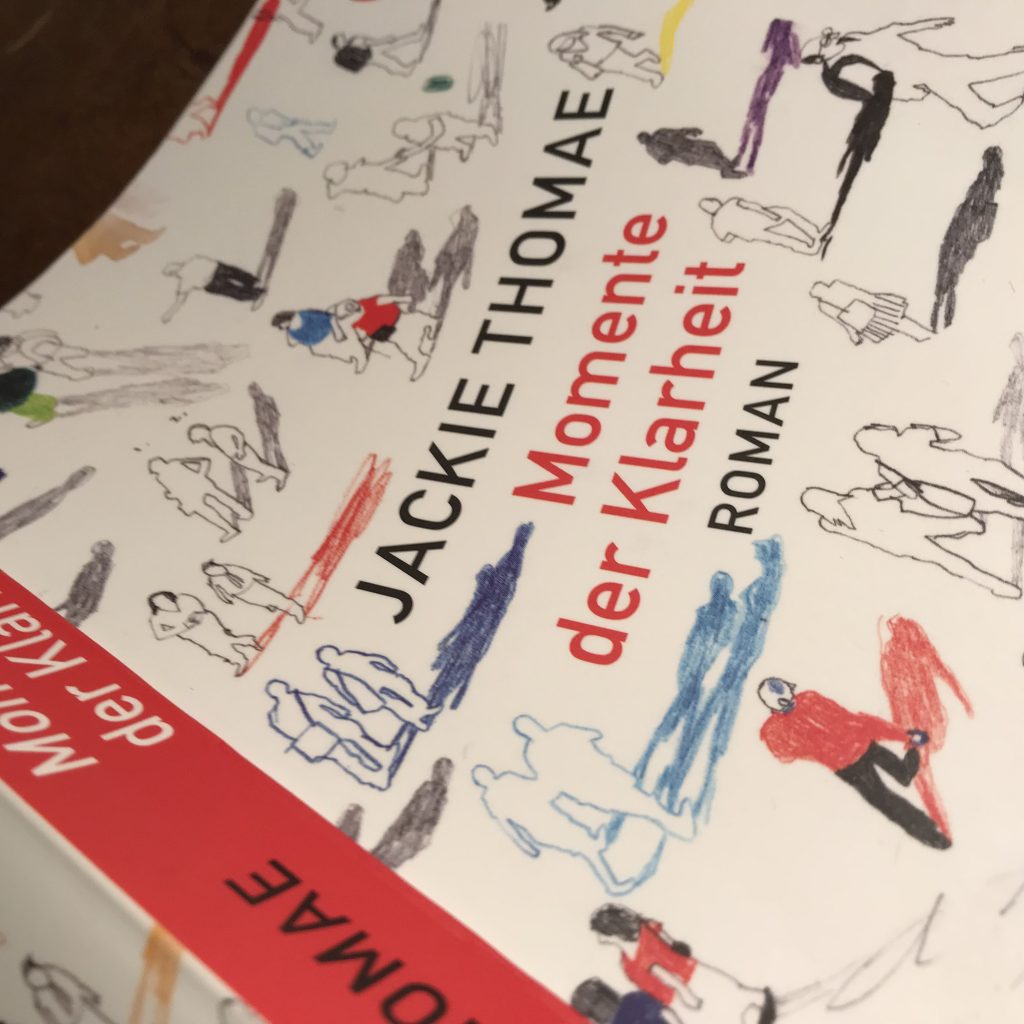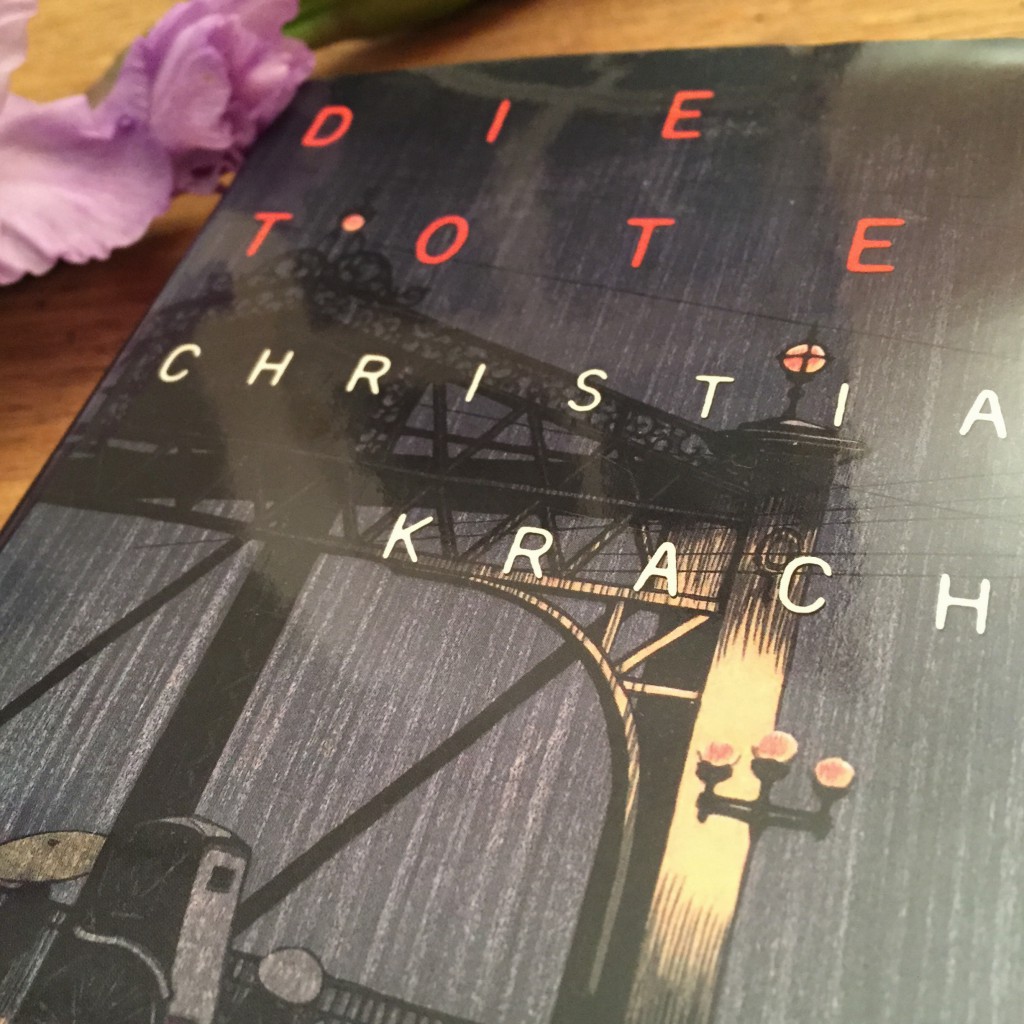Kurz ergreift mich das Bedürfnis, mit etwas zu werfen, aber was nützt das, wenn derjenige, nach dem man es werfen möchte, leider nicht anwesend ist, sondern einen telefonisch sozusagen verhöhnt, ohne das auch nur zu bemerken. Passenderweise ist es draußen dunkel und kalt, über die Fenster läuft schwarzer Regen, und obwohl es so aussieht, als würde es nie wieder hell, ist es eigentlich erst kurz nach fünf, und hier ist nicht der Hades, sondern bloß ein Büro.
Auch der Mann am anderen Ende der Telefonverbindung steht in einem Büro und wollte vor zehn Minuten mit mir über Kekse sprechen und über unsere Chancen, unsere Kinder doch noch christlich beschulen zu lassen und sie nicht dem gottlosen Berliner Bildungssystem in den schadhaften Rachen zu werfen. Von diesen Themen ist er dann allerdings abgekommen und nun sprechen wir seit zehn Minuten über Bücher. Ich lobe Kehlmanns „Tyll“, mit dem dem Meister des eleganten, ein wenig leblosen Plots nun wider Erwarten doch ein Roman gelungen ist, in dem der Dreck stinkt und Körper atmen, und in dem die Magie wirklich lebt und webt und nicht nur zitiert und behauptet wird. Aha, sagt er und schweigt für eine Minute. Dich, sage ich, um das Schweigen nicht über Gebühr auszudehnen, habe ich auch kürzlich zwischen zwei Buchdeckeln getroffen, und er lacht und fühlt sich, glaube ich, ein wenig geschmeichelt.
Ich dich auch, sagt er. Ich ziehe scharf die Luft ein und fürchte mich ein bisschen. In der Tat. Ich fürchte mich zu recht. Isabel, sagt er. Isabel in Jackie Thomaes „Momente der Klarheit“, dieses sehr wahre, sehr traurige, sehr treffsichere und unglaublich lustige Buch von vor ein paar Jahren über halb kreative, halb bürgerliche Mittvierziger in Berlin, die alle einmal etwas mit allen hatten, und in vielen kurzen Episoden jeweils den einen Moment erleben, in dem sie feststellen, dass die Liebe vorbei ist, und dann weitermachen oder auch nicht.
Wieso ausgerechnet Isabel, frage ich. War diese Isabel nicht Videokünstlerin? Ich habe eine intensive Abneigung gegen Videokunst. Und ist Isabel nicht eine ziemlich überspannte Person, die in Regisseur Engelhardt erst das Gefühl hervorgerufen hatte, ein jahrzehntelanger Irrtum habe sich endlich aufgeklärt, um dann Knall auf Fall zu einem Fremden zu ziehen, und Engelhardt auch noch den Umzug machen zu lassen? Eine Person, die im Personenverzeichnis als ebenso gewinnend wie angriffslustig bezeichnet wird? Die fiese, Haare ausreißende Schwester von Natalie, die eigentlich nur in emotionalen Extremen existiert? Die dann den total langweiligen Anwalt Clemens am Schlachtensee kennenlernt, der sich irgendwann von ihr trennt, weil sie sich offenkundig nicht die Bohne für ihn interessiert.
Ausgerechnet Isabel, ächze ich und überlege, ob eine Schädeldecke wohl bricht, wenn man mit einem schweren Locher auf sie einschlägt. Hier liegt ein Irrtum vor, proklamiere ich. Ich halte mich in der Tat eher für etwas zu kontrolliert als für das Gegenteil. Und ich mag manchmal Launen haben, aber ich bin Meilen entfernt von einer Frau, die die eigene Schwester für eine bisweilen gefährliche Borderlinerin hält, und nicht zuletzt seit über 20 Jahren in beispielhafter emotionaler Stabilität dem geschätzten Gefährten verbunden. Jaja, lacht man mich aus, und dann spricht man übergangslos wieder über Kekse.
Und hier sitze ich nun und denke darüber nach, welch schreiendes Unrecht es bedeutet, von seinen engsten Freunden so bösartig verkannt zu werden, und wie man sich hierfür als gesetzte Dame in durchaus mittleren Jahren am gediegensten rächt. Vorschläge gern in die Kommentare oder per E-Mail.