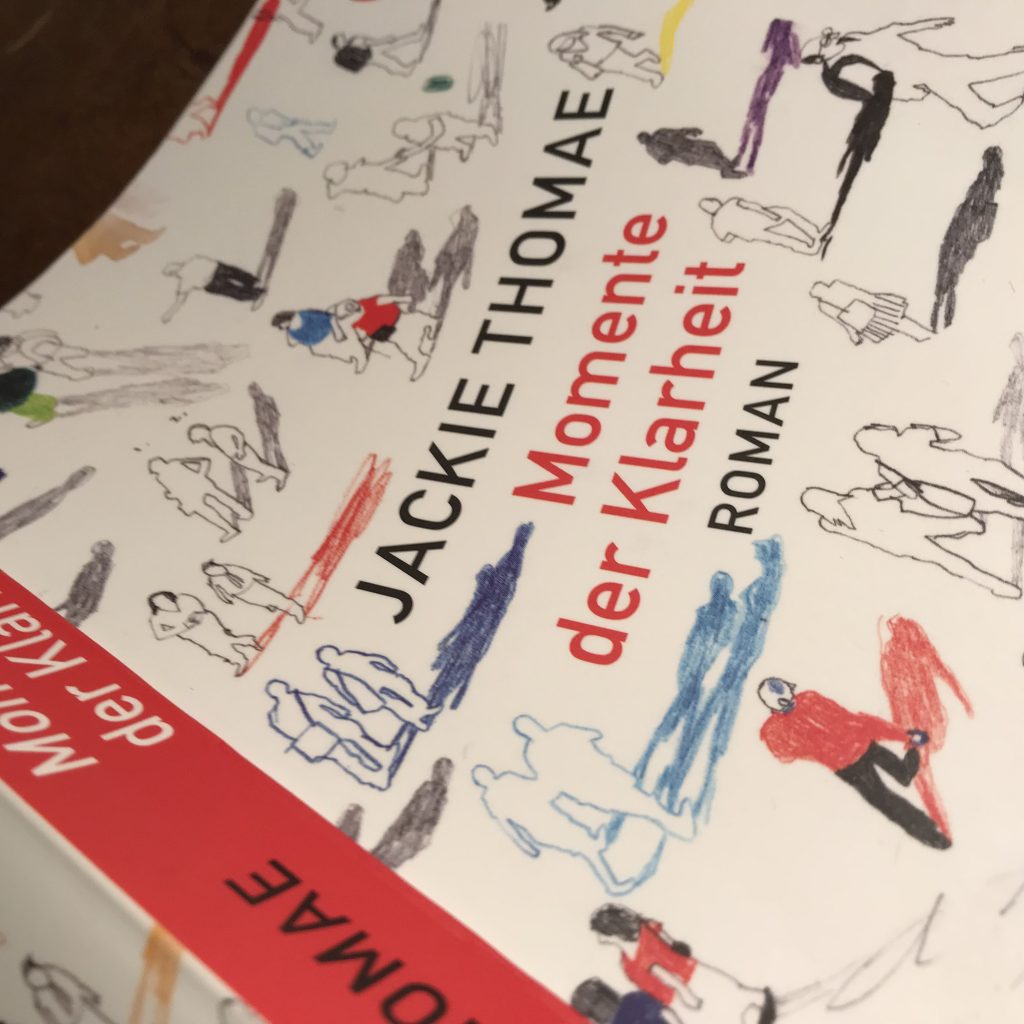Gut, schlimmer geht immer. Mein Sohn, der liebenswürdige F., könnte zum Beispiel Fußball spielen und ich würde jeden Samstagmorgen auf irgendeinem Sportplatz dieser ziemlich ausgedehnten Stadt der G-Jugend der Rotation Prenzlauer Berg dabei zuschauen, wie sie sich mit den Buben irgendeines anderen Clubs um den Ball balgt. Es wäre kalt und nass, aus großen Kannen würde saurer Kaffee ausgeschenkt, und außer mir wären alle anderen Eltern begeisterte Fußballfans und würden mit schrillen Schreien ihre Kinder anfeuern.
Doch auch das angenehmste, Fußball ganz und gar gleichgültig gegenüber stehende Kind hat seine dunklen Seiten. Ich etwa war heute das neunte Mal im Deutschen Historischen Museum, dem DHM. Sie haben richtig gelesen: Das neunte Mal. Und da sind die Besuche nicht mitgerechnet, die vorzeiten ohne den F. stattfanden.
Die Besuche verlaufen immer gleich. Der F. trabt im Laufschritt auf die Kasse zu, ich kaufe für 8 EUR eine Eintrittskarte und für weitere 3 händigt man dem F. einen Audioguide aus. Die ersten Male habe ich noch „deutsch, für Kinder“ gesagt, inzwischen sind wir Stammkunden und erhalten das Gerät mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der man Horst in der Eckkneipe ein Pils samt Korn hinstellt. Sodann läuft der F. alle 25 Stationen der Kinderführung ab, beginnend mit der Ritterzeit und endend mit dem ersten Weltkrieg. Kurz nachdem Scheidemann die Republik ausruft, ist Schluss. Was aus dieser Republik geworden ist, kann man im Untergeschoss sehen, wenn man älter ist als fünf.
Natürlich kenne ich jedes einzelne Exponat. Den Augsburger Jahreszyklus, die Pesthaube, die Bilder vom Sonnenkönig, vom Soldatenkönig, das erste Auto, das Berliner Mietshaus, na, die ganze Sammlung eben, und wenn es dem F. – was manchmal vorkommt – gelingt, andere Kinder zum Mitkommen zu überreden, höre ich auch jedesmal dieselben begeisterten Tiraden. Das Lieblingsbild des F. zeigt übrigens den Morgen nach der Schlacht von Waterloo.
Irgendwann so zwischen dem vierten und dem fünften Besuch wurde mir fad und ich begann, dem F. andere Museen anzupreisen. Ich habe eine Jahreskarte für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sollte sich schließlich lohnen, und so führte ich den F. zu den Römern und zu den Ägyptern, wir waren bei Sauriern und Heiligen, standen vor Nofretete und Caesar, aber nach jedem Besuch drängte der F. auf einen weiteren Rundgang durchs DHM.
Woanders ist es doch auch schön, behauptete ich, aber der F. ließ sich nicht erweichen. Nofretete hätte eine komische Krone. Die römischen Mosaiken in Zypern wären schöner und in seinem Römerbuch zudem besser zu sehen. Saurier wären nur was für Babies. Zuletzt, das war kurz nach Weihnachten, schleppte ich den F. ins Pergamonmuseum, und hinter dem Ischtartor, hinter dem Markttor von Milet und dem Codex Hammurabi entfuhr dem F. dann der finale Seufzer: Die Babylonier würden Löwen schlachten und wären daher fies. Die Assyrer hätten blöde Bärte.
Napoleon dagegen sei glattrasiert.